 Heute möchte ich zwei Themen mit euch teilen, die mir nicht nur persönlich am Herzen liegen, sondern auch zur Diskussion einladen – und zwar ausdrücklich mit euch gemeinsam. Mich interessiert nämlich eure Perspektive. Die Perspektive der Konsumierenden von Brettspielkritik, die zeitgleich integraler Bestandteil der Brettspiel-Community sind. Eure Gedanken, eure Kommentare sind nicht bloß willkommen – ich bin in gewisser Weise auf sie angewiesen.
Heute möchte ich zwei Themen mit euch teilen, die mir nicht nur persönlich am Herzen liegen, sondern auch zur Diskussion einladen – und zwar ausdrücklich mit euch gemeinsam. Mich interessiert nämlich eure Perspektive. Die Perspektive der Konsumierenden von Brettspielkritik, die zeitgleich integraler Bestandteil der Brettspiel-Community sind. Eure Gedanken, eure Kommentare sind nicht bloß willkommen – ich bin in gewisser Weise auf sie angewiesen.
Einblicke und Nachklänge vom Tag der Brettspielkritik 2025: Zwischen Anspruch und Perspektive
Vielleicht habt ihr es über andere Kanäle mitbekommen: Menschen, die sich professionell oder leidenschaftlich mit Brettspielen in Blogs, Podcasts, auf YouTube oder in klassischen Medienformaten beschäftigen, trafen sich in diesem Jahr zum vierten Mal beim Tag der Brettspielkritik. Auch ich durfte drei Tage lang Teil dieses intensiven Austauschs sein. In Workshops, Podiumsdiskussionen und Seminaren drehte sich vieles um die gemeinsame Auseinandersetzung mit dem Kulturgut Brettspiel und darum, wie wir Kritiker:innen diesem Kulturgut in Rezensionen gerecht werden können – oder sollten. Wer tiefer einsteigen möchte, sei auf die Website der Veranstaltung oder den Podcast Board Game Theory verwiesen, bei dem ich bei Olli mit Tim von den Teilzeithelden zu Gast war. Und damit willkommen bei der Nachbetrachtung zum Tag der Brettspielkritik 2025. An dieser Stelle jedoch möchte ich nicht den gesamten thematischen Kosmos aufrollen, sondern mich auf zwei ausgewählte Aspekte konzentrieren.
Tag der Brettspielkritik 2025: Die gute Brettspielkritik
Zum dritten Mal war ich nun Gast bei diesem besonderen Treffen – und unangefochten im Zentrum steht stets die gleiche Frage: Was ist gute Brettspielkritik? In der „Echo-Kammer“ der Rezensierenden scheint mittlerweile eine gewisse Einigkeit zu herrschen, vor allem wenn auf die Grundlagen geschaut wird. Im Jahr 2025 zum Beispiel ist die Vorstellung, eine Rezension müsse vor allem Regelmechaniken abbilden oder nach objektiven Maßstäben funktionieren, fast vollständig obsolet geworden. Brettspielkritik ist kein verlängerter Arm des Produkttests. Ich habe das so auch noch nie verstanden.
Interessanter ist indessen ein anderer Punkt. Es gibt Tendenzen von einigen, vielleicht sogar wenigen lautstarken Personen, hier gewisse Maßstäbe zu etablieren, die einen wesentlich stärkeren Fokus auf den Kontext von popkulturellen oder gesellschaftskritischen Bezügen legen. Nach Vorbild der Theater- oder Filmkritik im Feuilleton. Wie und warum wir etwas spielen, warum diese Spiele entstehen, aber auch rezipiert werden. Ist dieses Schlaglicht gewünscht? Soll Kritik also nicht nur das Spiel und deren Reize, durchaus im Kontext der spielenden Menschen, beschreiben und werten, sondern es zugleich in größere kulturelle und soziale Zusammenhänge einbetten? Und wenn ja, wie weit darf oder soll dieser Anspruch gehen? Wer ist die Leserschaft, die solche tiefgreifende Kontextualisierung überhaupt sucht? Allein meine Rückspiegelung der Frage an euch als eigene Zielgruppe würden diese Personen wohl als falschen Weg betrachten. Als fehlende normative Klarheit meinerseits. Denn für sie geht es vermutlich weniger um die Nachfrage als um eine selbstgesetzte Haltung: Kritik soll, aus dem Inneren der Kritiker:innen-Szene heraus, das Kulturgut Brettspiel nach außen stärken – durch Reflexion, Reibung und Relevanz.
Was macht diese aus?
Ich versuche hier seit Jahren einen Spagat. Unterhaltung, Persönlichkeit und damit eine gewisse Nähe, mit dem Fokus auf Spielreize, Emotionen und dem Spielerlebnis als Gruppe. Brettspiele über den womöglich zu erlebenden Spielspaß in die „Häuser“ anderer Menschen zu bringen, das ist Teilziel meinerseits. Brettspielkritik kommt dabei von mir, aber wie schon einmal thematisiert, niemals losgelöst von der eigenen Gruppe. Und ich sträube mich als neugieriger und offener Charakter sicher nicht gegen Veränderung. Aber wie stark braucht es immer eine Kontextualisierung zu popkulturellen oder gesellschaftlichen Aspekten? Gebärt es auch einen Mehrwert bei Titeln wie Instinkt – ist es dort überhaupt zu leisten? Der Kommentar von Tobias2 unter der Rezension ist eigentlich genau meine Maxime, mit jeweiliger Aufbrechung, wenn Titel etwas anderes zum Schwingen bringen und andere relevante Themen sich in den Vordergrund spielen. Wohin soll also die allgemeine Reise der Brettspielkritik gehen? Ist die Zielsetzung der Theater- oder Filmkritik im Feuilleton großer Zeitschriften der normative Gipfel?
Brettspielszene: Offenheit und Exklusion
Das zweite Element, das Teil unserer Diskussion werden soll, ist das vorgetragene Thema von Dr. Cosima Werner, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Kiel. Ihr Thema: Die Brettspiel-Szene im Spannungsfeld zwischen Offenheit und Exklusion. Ich kürze hier stark ab, weil es mir um eure Erfahrung geht und ich in wenigen Zeilen dem Vortrag nicht gerecht werden könnte. Wie gesagt, hört in den Podcast rein, wo ich ausführlicher über den fantastischen Vortrag berichte. Dr. Cosima Werner hat über 2 Jahre „unsere“ Szene begleitet, dabei empirisch untersucht, diverse Interviews geführt und ausgewertet. Die Vorstellung der Ergebnisse würde hier jeden Rahmen sprengen, allerdings hat sie als Außenstehende – sie selbst betreibt das Hobby nicht – durchaus den Finger in die Wunden unseres Hobbys gelegt. „Wunden“, die ich leider mit der Zeit selbst erleben durfte. Daher eine von mir interpretierte kurze Vorstellung zweier Themenfelder, damit danach hoffentlich die Diskussion starten kann.
Offenheit und familiär
Unser Hobby gilt aus der Szene selbst heraus als offen und tolerant. Wir „lieben“ Menschen und mit ihnen das Spielen. Es interessiert nicht, wer da an den Tisch kommt, wenn diese Person spielen will. Beruf? Gehalt? Herkunft? Sozialer Stand? Egal. Ein besonderer und positiver Mehrwert unserer Hobbys. Gleichzeitig beschreibt sich die Szene als familiär. Wir erschaffen im Miteinander intime Momente. Wir kommen uns am Tisch näher. Wir erleben uns. So wachsen Menschen zusammen und bilden Gruppen, wo sich ein Heimatgefühl durch Vertrautheit einstellen kann. Ich selbst habe durch Brettspiele so viele wunderbare Menschen kennenlernen dürfen wie wohl in keinem anderen Hobby. Ich unterstreiche diese beiden Punkte somit absolut.
Happyworld, exklusiv und arrogant?
Gleichzeitig erschafft sich die Szene eine Happyworld, wo viele Themen nicht stattfinden (dürfen). Wo gewisse Themen nerven. Eher werden diese abgewürgt als ausgetragen: Sexismus, Rassismus, Klassismus, „koloniale Denkweisen“ und deren Fortführung oder toxisches Verhalten am Tisch. Bei Unknowns, einem großen deutschen Brettspielforum, wird selbst bei Brettspielen mit politischen oder gesellschaftskritischen Themen die Besprechung solcher Themen im Kontext des Brettspiels nicht zugelassen. Nur in einem Sonderraum kann diskutiert werden. Brettspiele sind genial und wir wollen eine gute Zeit haben. Elemente, die hier kritisch eindringen, werden zur Seite geschoben.
Dazu gesellt sich eine elitäre Sichtweise auf andere Menschen, die anders oder nicht die richtigen Brettspiele spielen. Es gibt Tendenzen zu Deutungshoheiten, was richtige Brettspiele sind. Abwertungen von Brettspielen wie UNO oder Monopoly. Wenn auf einem Workshop davon berichtet wird, dass Jugendliche in einer Bücherhalle drei Stunden mit Feuereifer und Spaß, das Smartphone vergessend, Monopoly gespielt haben, gleichzeitig auf Rat aus unserer Szene Monopoly eigentlich gar nicht angeschafft werden sollte, dann frage ich, wo ist denn da die Offenheit? Wie elitär sind wir wirklich? Wie viele Menschen werden durch unser Verhalten, durch „gefeierte“ Nerdkultur, das „Kallax-Regal-Gepluster“ oder Fachsprache schon vor dem möglichen Einstieg ins Hobby abgeschreckt? Wie sehr muss ich mich rechtfertigen, mit einem narrativen Spiel Spaß zu haben? Oder sollte ich nicht lieber ein Buch lesen? The Mind? Noch Brettspiel genug? Wo stehen wir also als Community und habt ihr auch schon negativen Erfahrungen gesammelt?
Kommentare? Lasst es raus!
Falls ihr quatschen wollt, lasst gerne einen Kommentar hier. Dabei geht es mir wirklich um eure ganz persönliche Einschätzung, auch bitte und gerne über diesen Blog hinaus! Ein Richtig oder Falsch gibt es nicht. Auch Themen für die weiteren Monate werden gerne angenommen.
Fleischpöppel | Brettspieler | Videospieler | Rollenspieler | Miniaturenbemaler | Würfel-Lucker | Airbrush-Anfänger | Blogger | Schönspieler | Rum-Trinker | Brettspielsammler | Crowd-Funding-Süchtig | Trockner Grübler | Pöppel-Streichler | Magic-Verweigerer | 4X-Fanboy | Sickerflopp-Liebhaber
Im Fokus
Neueste Kommentare
- KK bei Same same but different
- KK bei Same same but different
- Christian bei Same same but different
- Gordon Shumway bei Same same but different
- Markus bei Same same but different







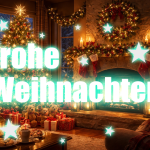


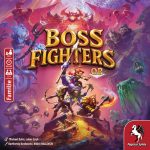
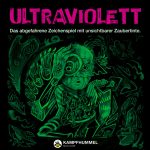

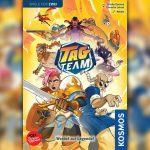

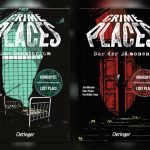


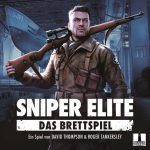
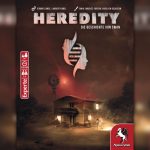



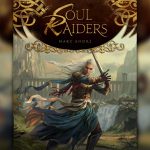

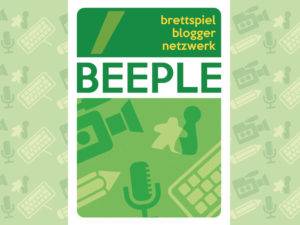

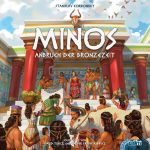


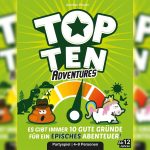

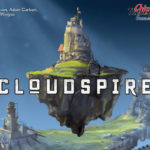
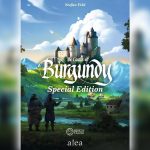




35 Kommentare. Hinterlasse eine Antwort
„Gleichzeitig erschafft sich die Szene eine Happyworld, wo viele Themen nicht stattfinden (dürfen).“
Ja, das ist leider so – und für mich auch nur sehr schwer zu ertragen! Ich beschränke mich inzwischen darauf, die Farben Blau und Gelb nicht gleichzeitig im Spiel haben zu wollen, wenn es sich irgendwie vermeiden lässt…
…und mir ein gewisses pnp-social-deduction-Spiel neben der Originalversion zusätzlich noch in einer anderen, eher unverfänglichen gebastelt zu haben, auch wenn ich selbst thematisch da kaum am tabletalk teilnehmen kann (Geschichte hatte schliesslich jeder in der Schule, die StarWars-Saga steht aber mW auf keinem Lehrplan oder ist sonst irgendwie Pflicht) – manche Mitspieler wollen das aber offenbar so!
Was wurde mir da schon alles vorgeworfen, weia… sachliche Diskussion nicht möglich!
Hallo KK;
vielen Dank für deinen Einblick. Zunächst Service: Warum auch immer, aber ein paar Links waren in der veröffentlichten Version rausgeflogen. Diese sind nun enthalten (Podcast und Tim als Gesprächspartner). Falls dich also das Themenfeld interesssiert, kann ich dir die Folge des Podcasts empfehlen.
Zu deinen Erfahrungen: Vielen Dank für deine Mitteilung. Kann ich nachvollziehen und passt aus meiner Sicht ziemlich gut zum Thema der Diskrepanz zwischen Selbstbeschreibung der Community (die ich eigentlich auch teile) und der erlebten Realität.
Da du hier ja öfters schreibst, würde ich mich noch freuen, zu erfahren, was du zum ersten Themenblock für eine Meinung hast.
Liebe Grüße
Christian
Hab gestern Nacht erste Gedanken dazu bei „Instinkt“ hinterlassen, weil es als Antwort auf den oben verlinkten Kommentar passt – für ausführlicheres komm ich derzeit nicht, bin auch gerade wieder auf dem Sprung.
https://brettundpad.de/2025/07/14/instinkt/#comment-19171
Vielen Dank für deinen Einblick. Durch solche Kritik können wir uns ja auch verbessern. Komplexität ist manchmal überraschenderweise auch eine sehr subjektive Sache. Ein On Mars empfinde ich z.B. als sehr gut spielbar und ich wundere mich jedes Mal über das hohe „Weight“ bei BGG. Magst du einmal die Titel nennen, wo die Komplexität nicht gut rübergekommen ist?
1. Unterschätzt hatte ich „The THING“ und „Mind MGMT“ – aber das war noch in meiner Anfangszeit, nachdem ich mich nach längerer Pause wieder mit Brettspielen beschäftige und noch nicht lange hier mitgelesen hatte (also meiner Unbedarftheit geschuldet) – die beiden Spiele haben hinsichtlich Thema (Hidden Role/-Movement) meinen Nerv getroffen, aber ich werde die niemals erklärt bekommen (wobei ich bei Mind MGMT schon selbst erhebliche Probleme mit der Regel habe und bei The THING eben Nachfragen im Spiel schwierig sein kann, ohne die Rolle zu spoilern, da muss die Erklärung 100% passen oder sich jeder vorher selbst damit gut beschäftigen).
2. Zu Lacerda:
Hatte mir „Mercado de Lisboa“ als Einstieg in die Lacerda-Welt gekauft und finde das total geil: in wenigen Minuten erklärt und begriffen, aber eine wie ich finde sehr interaktive Tiefe bei angenehmer Spielzeit. Dann in einem öffentlichen Spieletreff „House Of Fado“ gelernt – damit war der Weg frei für die „richtigen“ Lacerdas:
Habe mir unlängst mit einer Freundin, mit der ich regelmässig spiele, das gebraucht schon vor einiger Zeit sehr günstig geschossene „The Gallerist“ draufgeschafft (Kunsthandel als Thema, seit Wolfgang Beltracchi genau mein Ding) – mei, das war richtig Arbeit (trotz der Vorarbeit mit „House Of Fado“): Die Erstpartie inkl. gemeinsamem Regelstudium bei Null angefangen hat allein über sieben Stunden gedauert. Aber es ist alles schlüssig und nach inzwischen drei Spielen läuft es schon recht gut.
Letzte Woche noch mit einem anderen regelmässigen Spielpartner eine erste Zweier-Lernrunde (mit „Sandra“) auf dessen „Escape Plan“ gedreht, was mir noch etwas leichter zugänglich erscheint – aber auch sehr geil: da guck ich jetzt auch mal gebraucht nach einem Schnapp; der sich aufbauende Spielplan, ein wenig vorausschauende Deduktion wegen der sich schliessenden Fluchtwege und die Interaktion sind für ein EURO echt aussergewöhnlich.
Aber das reicht mit für dieses Jahr dann auch an neuen komplexen Spielen – bei den beiden Lacerdas hab ich den Eindruck, dass sich die Mühe lohnt, weil man sehr in die Thematik hineingezogen wird, die Symbolik recht gut im Hirn „kleben“ bleibt und ich den Eindruck habe, damit etwas ganz besonderes zu spielen. On Mars reizt mich jetzt vom Thema wie auch die anderen Lacerdas nicht sonderlich, das ist bei Gallerist und Escape Plan anders…
3. Hatte ich erwähnt, dass ich jetzt auch „Blood Rage“ für mich entdeckt hatte? Da warte ich noch auf eine Antwort auf meine Frage bei STAUB oder SCHATZ bezgl. der Erweiterungen 😉
Noch was zu Komplexität:
Sich mal mit einem komplexen Regelwerk zu beschäftigen, wenn mich das Spiel als solches zB wegen der Thematik interessiert, ist für mich durchaus OK.
Was mich stört sind die inzwischen jedes Jahr in immer grösserer Menge herauskommenden Spiele, die mir alle immer nur wie ein Aufguss des immergleichen scheinen (Punktesammeln in einem jeweils abgewandelten Mechanikmix mit mehr oder weniger aufgesetztem Thema) – mit Regelwerken, die vom Umfang den AGB eines Digitalkonzerns nahekommen (weil ich dann ähnlich jenen irgendwann beim Lesen das Hirn ausschalte oder ganz abbreche). Extrembeispiele sind dann sowas wie TERRA MYSTICA, GAIA PROJECT und AGE OF INNOVATION – da hat man aus einem Spiel dann über die Jahre drei gemacht! Bei DUNE IMPERIUM hat man auch damit angefangen… Kapitalismus halt!
Das Problem ist nicht das einzelne Spiel, sondern die vielen Spieler, die möglichst viele davon zwischen zwei Essen (der Messe, nicht die Mahlzeiten) auf den Tisch bringen wollen – und will man irgendwo regelmässig mitspielen damit konfrontiert wird, ständig neue Regelnmonster lernen zu müssen… dann meisst nicht hinreichend korrekt und/oder vollständig in lauter Umgebung bei öffentlichen Treffs vorgetragen.
Von den Rezensionen würde ich mir persönlich wünschen, dass sie viel öfter von solchen komplexen Spielen abschrecken als dazu zu verleiten, das würde mein Problem vielleicht etwas reduzieren…
Das von mir wegen seiner Zugänglichkeit sehr geschätzte Mercado de Lisboa wurde hingegen in vielen Rezensionen regelrecht zerrissen, weswegen es viele gar nicht erst mitspielen wollen… (offenbar, weil es nicht oft genug auf den Tisch kam, um die Tiefe zu ergründen – die Rezensenten haben ja noch so viele Klopper auf dem Tisch vor sich, da muss die Meinung immer schnell gebildet sein).
Bei komplexen Spielen hab ich es genau anders herum erlebt – da werden einige direkt über den grünen Klee in den Nachthimmel gelobt, und nach einiger Zeit kann man dann in den Foren lesen oder bei Treffs beobachten, dass die Faszination vergleichsweise schnell nachlässt und jetzt auf die meisst dann schon angekündigte Erweiterung gewartet, die dann Fehler oder Unausgewogenheiten ausgleichen soll.
Hier lese ich eigentlich hauptsächlich wegen der launigen Art der Schreibe – die meissten der hier vorgestellten Spiele spielen in für mich nicht zugänglichen Sphären- sei es vom Regelumfang oder der Thematik 😉
„Soll Kritik also nicht nur das Spiel und deren Reize, durchaus im Kontext der spielenden Menschen, beschreiben und werten, sondern es zugleich in größere kulturelle und soziale Zusammenhänge einbetten?“
Interessante Frage, aber ich sehe hier – auch bei Filmkritiken – immer wieder ein Problem: noch mehr als bei „klassischen“ Kritiken kommt hier die Subjektivität des Rezensierenden zum Vorschein und seine persönliche Einschätzung der (pop)kutlurellen/sozialen Einbettung des Titels.
Zwei Beispiele hierzu, die das evtl. nachvollziehbarer machen: 1) Dietmar Dath, Autor und Feuilletonist (früher, unter anderem, bei der FAZ) hat vor mehreren Jahren den Marvel-Kinofilm „Dr, Strange“ rezensiert, Er schwärmte von dem Film, beschreibt, wie anders dieser im Vergleich zu den übrigen Titeln des Franchise gestaltet ist usw. Also entschied ich – obwohl mir die Marvel-Titel noch nie irgendwas gegeben haben – dem Film eine Chance zu geben. Vielleicht hebt dieser ja wirklich die Idee des Superhelden-Films auf die nächste Ebene, war mein Gedanke. Als ich ihn dann gesehen hatte, war ich ernüchtert. Im Grunde war es für mich genau der gleiche Brei und Aufbau wie alle anderen Titel der Reihe (Aufstieg, Krise, Wiederaufstieg und Verstetigung). Jetzt ist es so, dass besagter Dietmar Dath ein großer Fan der zugrundeliegenden Comics und damit generell tief in der zugehörigen Hintergrundwelt bewandert ist. Und ich vermute, ohne den Mann zu kennen und damit seine Gedankenwelten, dass er deswegen vermutlich viel mehr in dem Film sehen und hineininterpretieren konnte als ich. Für mich war es nur irgendein neuer Held mir irgendwelchen neuen Kräften, für ihn war es einer seiner liebsten Comics, der endlich verfilmt wurde. Ich habe mich hier also evtl. aus den falschen Gründen begeistern lassen.
Zweites Beispiel: in der englischen Rezensentenszene gibt es Dan Thurot, der regelmäßig sehr ausführliche, teils fast schon literarisch geprägte Rezensionen zu aktuellen Brettspieltiteln verfasst. Diese lesen sich oft so begeistert und von dem jeweiligen Titel überzeugt, dass ich sofort Lust bekomme, dass Spiel auszuprobieren. Es werden kulturelle Kommentare betont, die das jeweilige Spiel liefert, es wird hervorgehoben, wie einzelne Mechanismen kongenial gesellschaftliche Realitäten abbilden usw. – dann sitze ich am Spielbrett und frage mich, ob dieser Mann nicht manchmal dem Kulturgut „Brettspiel“ zuviel zumutet. Oft erscheint es mir dann, dass er mehr viel mehr darin sehen wollte, als vorhanden ist. Und wenn man um die Genese von Spielen weiß, sind ja sehr oft zuerst die Mechanismen da und dann wird ein passendes Thema gesucht – oft nicht einmal vom Autor/der Autorin selbst, sondern vom Verlag. Ob dann wirklich soviel gesellschaftlicher, zeitkritischer Kommentar etc. vorhanden ist, sei also dahingestellt und natürlich nicht endgültig zu klären. Fakt ist: oft schien es mir, dass die Gedanken- und Vorstellungswelt des Rezensenten da mit ihm durchgegangen ist. Und das ist ja auch großartig, dass man eine Immersion erlebt, sich in die Spielwelt hineinversetzt etc. – das passiert ja auch in diesem Blog hier immer wieder. Aber bei Thurots Rezensionen ufert diese Ebene oft soweit aus, dass das eigentliche Spiel hinter der Begeisterung über die vermeintliche Metaebene verschwindet und so der Wert der Rezension als Spielempfehlung für mich deutlich leidet.
Das ist die große Herausforderung für das Rezensieren: das emotionslose Beschreiben von Mechaniken ergibt genauso wenig Sinn, wie der zu weite Sprung in die Metaebene. Im Endeffekt muss man es schaffen, klarzumachen, wie das Spiel mechanisch verläuft und dabei deutlich machen, welche Emotionen und Gedankenwelten diese Mechanismen erwecken (können). Und das ist ja auch unerlässlich, weil nahezu jedes Kulturgut, dass einen begeistern kann, mehr als die Summe seiner einzelnen Teile (siehe unseren kurzen Austausch zu „How to save a world“) ist. Dann werden gezogene Plastikwürfel in einem Stoffbeutel plötzlich zum Gericht über das Schicksal einer ganzen Welt usw. – Für den Leser solcher Rezensionen hat es zur Folge, dass man ein Gefühl dafür entwickeln muss, welche Dinge welche Rezensenten zu begeistern wissen und inwiefern sich diese Begeisterung mit der eigenen Wahrnehmung von Spielen deckt.
Und diese persönliche Einschätzung einzelner Titel und des Mediums Spiel als Ganzes sind m.E. auch die Ursache für die teils „elitär“ wirkenden Umtriebe in der Szene. In meine Spielgruppen an der Schule (ich bin Lehrer) hatte ich zu Beginn auch sehr hehre Ziele, wollte den Kindern das ganze Spektrum der modernen Spielewelt zeigen. Am Ende saßen sie aber regelmäßig da, spielten Monopoly oder eben UNO. Natürlich probierte einige dann auch von mir angebotene Titel aus und konnten sich dafür begeistern (wobei diese auch eher auf der zugänglichen Seite des Spektrums waren). Einige blieben aber bei vorgenannten Titeln – und sie hatten eine richtig gute Zeit und jede Menge Spaß. Und was solls dann auch? Ich habe als Kind auch Stunden mit Monopoly verbracht, hielt Risiko für ein tiefgründiges Strategiespiel und UNO fand ich auch eine Weile in Ordnung. Vielleicht hätte ich auch anderes gespielt, hätte es mir jemand angetragen. Aber wichtig ist doch, dass wir damals gemeinsam eine gute Zeit hatten. Und darum geht es doch auch heute noch, zumindest empfinde ich das so. Und nicht jeder hat mit den gleichen Spielerlebnissen eine gute Zeit. Mancher mag Konflikt in Spielen nicht, ein Anderer findet interaktionsarme Spiele langweilig. Einige sehen digitale Elemente in Brettspielen als Untergang des Abendlandes, andere sehen es als Chance.
Und so ist es ja bei vielen Unterhaltungsmedien: CGI erregt immer wieder die Gemüter im Kino, bei Musik war es Autotune, dass als Katastrophe gesehen wurde. Und bei jedem dieser Medien entwickelt sich stets ein „Elfenbeinturm“ derer, die glauben, dass jeweilige Medium tiefer und reflektierter durchdrungen zu haben als die Anderen.
Grundsätzlich sehe ich es bei Diskussionen über das Medium Spiel also wie bei allen anderen hier besprochenen Medien: man sollte nicht den Geschmack anderer aburteilen, ihnen die Expertise aberkennen. Man kann sachlich aufführen, was man selbst als gut empfindet oder warum bestimmte Elemente einen nicht begeistern. Im Grunde sieht sich also die Diskussion in den Kommentarspalten der gleichen Herausforderung gegenüber wie die Rezension selbst: anhand der Mechanismen/Struktur des Spiels beschreiben, was einen warum begeistert und welche Emotionen das auslöst. Und sich ggf. bemühen zu verstehen/nachzuvollziehen, warum andere das anders sehen. Oder es einfach hinnehmen, dass andere das eben anders empfinden, ohne sich über sie zu stellen, weil man sich für vermeintlich klüger/reflektierter hält.
Am Ende glaube ich, dass die Brettspielszene insgesamt eine inklusivere Basis hat als andere Hobbys – eben auch, weil man im Grund auf Spielgruppen und Mitspieler angewiesen ist; das impliziert das Hobby (jenseits von Solotiteln). Anderseits ist Szene auch nur ein kleiner Spiegel der Gesellschaft und hat die gleichen Herausforderungen und Probleme wie diese als Ganzes. Denn das im letzten Absatz Geschriebene könnte man – geringfügig abgeändert – auch für politische Diskussionen über Lösungen für gesellschaftliche Themen postulieren. Und hier wie da sehen wir, dass Wunsch und Realität sich oft deutlich unterscheiden.
Hallo Tobias,
wow … was für ein Kommentar! Ich habe über deine Worte nun einige Zeit nachgedacht und kann deine Ausführungen größtenteils unterschreiben. Zur Rezension und der Brettspielkritik empfinde ich diese ausschweifende Metaebene als schwierig, genau aus deinen aufgeführten Punkten. Es kann sicher gelegentlich sehr bereichernd sein, und die ein oder andere Rezension hätte hier vielleicht auch mehr davon vertragen können. Letzendlich ist dieser Punkt für mich aber eben nicht die große Maxime an die sich alle orientieren sollten. Und genau das sollte aus meiner Sicht dann in der Blase der Rezensierenden diskutiert werden.
Zu dem anderen Punkt: Klar, unser Hobby kann nicht losgelöst von gesellschaftlichen und damit allgemeinen Problemen betrachtet werden. Und dein Punkt, dass das Hobby Brettspiele ebenjene Geselligkeit braucht, bedingt gewisse Grundzüge in der Szene. Das sehe ich ähnlich. Vergleiche ich diese Szene aber mit anderen Szenen (z. B. Rennradfahren, Wassersport, Kitesurfen), ist dort die Diskrepanz gefühlt niedriger. Inklusivität ist dort nicht unbedingt ein Schlagwort, welches den Hobbyisten als Beschreibung ihrer Szene wohl direkt einfallen würde. Im Gegenteil, teilweise wird eine gewisse Exklusivität durch Abgrenzungs- und Abwertungstendenzen sogar gefördert. Trotzdem ist die Brettspielszene eben durch diverse exklusive Verhaltensweisen durchzogen, was dann im krassen Widerspruch zum gefühlten und nach außen hin propagierten Bild steht. Im Vortrag von Cosima wurde beispielsweise auch das „weißsein“ der Szene betrachtet. Das Motto ist „Spielend für Toleranz“. Diese Toleranz mag vorhanden sein, sie führt aber nicht zu dem Ergebnis, für welches diese Toleranz eigentlich steht. Die Blase besitzt eine Membran nach außen, die viele Personenkreise nicht durchdringen. „Weißsein“ betrifft sicher auch viele andere Sportarten. Aber selbst bei meinem eher elitären Rennradfahren sehe ich dort mehr Veränderung als bei der toleranten und offenen Brettspielszene. Das ist jetzt keine Pauschalkritik am Hobby, noch habe ich Lösungen, ich finde die Betrachtung einfach nur spannend.
Es wurde zwar mittlerweile schon an anderer Stelle dieses Kommentarbereichs diskutiert, aber nochmal ein paar Worte zu der Inklusivität. Das man „Spielend für Tolenranz“ ist und sich als inklusiv sieht, ist für die Szene – wenn man es etwas böse sagen will – recht wohlfeil. Man hat Spieletreffs, wo theoretisch jeder hinkommen kann. Man freut sich zumeist über MitspielerInnen. Man braucht weder besondere Ausrüstung, noch übermäßiges Spezialwissen. Aber sind z.B. Spieletreffs deshalb besonders tolerant oder inklusiv? Wahrscheinlich nicht. Im Grunde kommt da ja zumeist Klientel, die sowieso schon einen gewissen Zugang zum Hobby hat. Sicher – wenn sie entsprechend „beworben“ werden – verirrt sich auch mal jemand dorthin, der gar keine Erfahrung mit dem Hobby hat. Und je nachdem wie diese Person aufgenommen wird, kommt sie vielleicht auch nochmal wieder. Bei vielen Spieletreffs sieht man aber ehrlicherweise immer die gleichen Personen; oftmals kommen die Leute ja auch dorthin, um neue Titel auszuprobieren und dazu braucht es eigentlich erfahrene Mitspieler – man sucht also evtl. garnicht nach neuen Kontakten oder will Leute ins Hobby bringen.
Warum Frauen und Menschen mit Migrationshintergrund so gering vertreten sind, hat sicher viele Gründe. Kulturelle Prägungen, Rollenmodelle, finanzielle Möglichkeiten (nicht nur für die Spiele als solche, sondern auch um die Freizeit aufzubringen, um zu partizipieren). Auch die gerne gemachte Behauptung, dass jeder mit jedem spielen kann und Spiele auch Sprache überwinden, ist, gerade in unserer Nische der Kenner- und Expertenspiele, auch nur sehr bedingt wahr. Wenn ich einen komplexen Titel erklären will, muss ich auch ziemlich komplexe Zusammenhänge vermitteln. Auch Kartentexte sind ein Hindernis.
Noch ein Wort zu Themen wie Gender, Rassismus, Kolonialismus etc im Brettspiel: die Diskussion findet ja dankenswerterweise mittlerweile statt, aber ist in der Szene aber oft leider genauso verhärtet oder oberflächlich wie in der Gesellschaft als solcher ingesamt. Positiv ist in jedem Fall, dass Verlage inzwischen oft kulturelle BeraterInnen haben und auch Spielcharaktere wesentlich diverser geworden sind und werden.
Insgesamt finde ich es schwierig, hier Grenzen zu ziehen: ist es okay, kolonialistische Themen zu spielen? Was ist mit den Weltkriegen? Und sind die napoleonischen Kriege deshalb „okayer“, weil sie einfach schon länger her sind? Dürfen Spiele ahistorisch sein, um Diversität besser abzubilden? Bräuchten Spiele, die sensible Themen aufgreifen, eine kommentierte Edition?
Ich glaube der Trend zu den süßen Tieren und Fantasiewelten funktioniert ja auch deshalb, weil man sich dann aus diesem Spannungsfeld herauszieht – man stelle sich vor „Root“ wäre mit klassischem Wargame-Thema versehen; wahrscheinlich wäre es nie derart kontroversenfrei im Mainstream unserer Szene angekommen.
Eine Frage noch zu dem Podium, vielleicht wurde es auch schon irgendwo geschrieben, ich habe nicht mehr alles im Überblick: was hat denn die Referentin als Ursache für die geringe Diversität der Szene ausgemacht (falls sie etwas dazu gesagt hat)?
Ich glaube ja, dass du dir die Antwort im Grunde weiter oben bereits selbst gegeben hast. Es ist – wie du auch schreibst – immer ein Abbild oder, wie du sagst, ein Spiegel der Gesellschaft.
Wenn bestimmte Menschengruppen gesellschaftlich generell am Rand anzutreffen sind, dann spiegelt sich das eben auch in dieser Szene wider – sei es bei Spieletreffs, in der Brettspielkultur oder in der thematischen Auswahl von Spielen.
Die Fragen, die ich mir stelle, gehen deshalb eher in eine andere Richtung: Warum sollten gerade Spieletreffs besonders inklusiv oder tolerant sein? Wieso sollte dieser Teil unserer Gesellschaft in besonderer Weise gegen solche Missstände wirken?
Ja, es stimmt – sie könnten Räume sein, die durch gemeinsame Regeln, Fantasie und Kooperation Menschen zusammenbringen, die im Alltag wenig Berührungspunkte haben. Die Hoffnung ist: Wenn man sich gemeinsam auf imaginäre Welten einlässt, vielleicht sogar Rollen einnimmt, die der eigenen sozialen Position widersprechen, dann könnte das zu mehr Empathie, Verständnis und Offenheit führen.
Aber: Das passiert nicht automatisch. Und es passiert auch nicht einfach, weil man es sich vornimmt oder fordert.
Habe gerade nicht so viel Zeit, daher nur ganz kurz. Es geht in erster Linie nicht um Lösungen, es geht um Reflektion und die Untersuchung eines Ist-Zustands. Eine Szene beschreibt sich als offen und familiär. Das steht in der „Untersuchung“ aber in einem Kontrast zum Verhalten und den Erfahrungen im Hobby. Wenn ein sehr großer Teil der Szene unser Hobby als offen bezeichnet, aber Monopoly oder Thr Mind Unspiele sind oder große Teile gleichzeitig gewisse Themen an den Rand drängen bzw. sie nicht stattfinden, dann ist das doch eine große und interessante diskrepanz. Natürlich bildet sich Gesellschaft in Hobby und deren „Standing“ ab. Das ist aber nicht der Punkt. Und der Punkt ist auch nicht, dass unser Hobby jetzt diese Probleme löst. Ich betreibe auch Rennradfahren. Ich bezweifle, dass dort Menschen ihr Hobby als „offen“ bezeichnen und ich würde sogar eher sehen, es ist elitär. Entsprechend ist dort die Diskrepanz zwischen Hobbybeschreibung und einer wirklichen Realität so groß. Und es muss auch nicht immer das ganze große Thema sein (wie sich hier jetzt etwas drauf fokussiert wurde). Es fängt doch damit an, dass mir als Forumuser und absoluter Fan von Tainted Grail z.B. immer wieder geraten wurde ein Buch zu lesen und Tainted Grail wäre kein Spiel. Ist das offen? Nein. Das ist elitäres Denken, wo Menschen bestimmen wollen, was richtiges Spielen ist. Darum habe ich auch nach solchen Erfahrungen gesprochen.
Manchmal liest man gerne einen Roman, manchmal schaut man ein lustiges Video.
Das tolle an der Brettspielkritik ist, dass sie mehrere Bedürfnisse erfüllen kann. Es gibt Kritiken, da macht es einfach Spaß den Text zu lesen. Egal ob man das Spiel jemals spielen wird. Es gibt aber auch Situationen, da will man einfach wissen, soll ich mir das kaufen. Dann brauchst du in dem Moment eine andere Art von Kritik.
Aber das ist ja bei der Filmkritik nicht anders. Manchmal reicht mir schon eine toll geschriebene Kritik zu lesen und manchmal will ich nur wissen, ob der Film der jetzt heute hier im Kino läuft gut oder Grütze ist.
Darum ist die Antwort:
Es kommt drauf an.
Jedoch gibt es für den schnellen Überblick ja auch schon BGG und die Kommentare dort, darum hat vielleicht die ‚Literarische Kulturkritik‘ eher ihren Platz auf einem Blog, wie dem euren.
Natürlich werdet ihr nie an Udo Bartsch heran kommen, aber auch hier gibt es immer wieder Texte, wo ich Spaß am lesen habe, auch wenn ich weiß, dass ich das Spiel nie spielen werde.
Insofern: zielt hoch.
Hinc itur ad astra!
Hallo Florian,
mit Udo Bartsch habe ich schon sehr intensiv zusammengearbeitet und das war sehr erquickend. Ich glaube, wir haben am Ende schon noch eine andere Art der guten Brettspielkritik vor Augen und sind da verschieden, aber wovor ich absolute Hochachtung habe, ist seine immense Fähigkeit der Prägnanz und Kürze. Ich bin oft, nicht immer zufrieden mit meinen Rezensionen, aber ich finde sie grundsätzlich zu lang. 😀 Da ist Udo ein Meister drin.
Vielleicht siehst du das anders, aber die Rezensionen von Udo Bartsch empfinde ich im Kontext dieses Artikels auch nicht als besonders kontextualisiert. Popkulturelle Bezüge oder gesellschaftskritische sehe ich da wenig. Siehst du das anders?
Liebe Grüße
Christian
„…seine immense Fähigkeit der Prägnanz und Kürze.“
Er lässt halt die Einleitungen weg 😉
Na ganz ohne Augenzwinkern war der Verweis auf Udo Bartsch nicht gemeint, aber was der schafft ist es, Texte zu schreiben, die ich um des Textes Willen lese. Unabhängig davon, welches Produkt da beschrieben wird.
Gesellschaftskritik sehe ich da auch nicht, aber davon habe ich ja auch nix geschrieben.
Abgesehen davon, dass Udo gendert und mit Huhni ganz klar gegen Massentierhaltung und für mehr Plüsch in der Welt steht ☝️
Leichtigkeit, Humor und sehr gute Einleitungen sind außerdem noch bartsche Tugenden. Vor allem letzteres…traun fürwahr… Daran kann man sich orientieren. Muss man geradezu.
Ein Blog muss zuallererst als Blog funktionieren, ob das jetzt Journalismus ist oder Influencerei, völlig egal.
Außerdem muss man sich zwingend davon frei machen, darauf zu hören, was andere Leute sagen, was man muss oder wie ein Blog, ein Text oder so zu sein hat.
Billy Wilder hat angeblich gesagt: du darfst nicht langweilen. Auf den müsst ihr hören. Aber keinesfalls solltet ihr euch von den paar Leuten beim TdBK auf den Panel oder noch schlimmer von den paar Hansel:innen in euren Kommentaren, sagen lassen wie ihr es machen müsst.
Und ihr müsst ganz viel Ambiguitätstoleranz haben, denn ohne diese, macht mein ganzer Kommentar überhaupt keinen Sinn 😉
Hi Ihr Lieben,
ich bin in dieser Diskussion auf vielen Ebenen und in unterschiedlichen Gesprächen involviert. Ich schreibe Rezensionen, weil ich gerne mit Worten spiele. Ich habe ein abgeschlossenes Hochschulstudium und ein zweites Staatsexamen, allerdings keine journalistische Ausbildung.
Ich bin zu diesem Blog zufällig gekommen, reingeschlittert. Was bin ich also?
Ich greife die Frage von Christian auf: Was macht uns aus?
Die Perspektive, was den Blog Brett & Pad ausmacht wird an unsere tollen Leser:innen gespiegelt und ich sauge jede eurer Perspektiven auf. Warum? Nun, ich habe eine sehr konkrete Vorstellung von Dingen, gleiche diese aber immer mit anderen Perspektiven ab. Ich liebe den Diskurs, ohne dabei eine Meinung als richtig und als falsch abzutun.
Jemand liebt Unboxing Videos? Hervorragend, er hat seine Berechtigung, weil ihm das gefällt und er wahrscheinlich Leute damit begeistern kann. Jemand schreibt Rezensionen zu Brettspielen und verordnet sich eher im Feuilleton, als im Bereich der Information/ Unterhaltung? Ein toller Ansatz. Ich lese diese Berichte oder Artikel sehr gerne, weil ich mich informiere, meine Blick erweitere, schärfe oder reflektiere. Eine Rezension ist eine Abhandlung von Regeln und Mechaniken? Ein berechtigter Ansatz, allerdings nichts, was ich gerne lese.
Mein Problem bei dieser ganzen Geschichte: Dogmatisches Bekehren der Anderen oder Festlegen von Kriterien. Wenn wir uns normativ oder per Absprache (wie in einer sozialen Gemeinschaft) üblich, über allgemein gütige Kriterien zu Rezensionen einigen könnten, dann wäre es gut. Allerdings habe ich ein großes Problem damit, wenn sich selbsternannte Kritiker über andere erheben und sagen: Das ist eine und eben das nicht.
Ich, als Blogger entscheide, was ich wie in meiner Rezension beleuchte. In vielen Brettspielen sehe ich diese gesellschaftlichen, historischen oder popkulturellen Kontextbezüge nicht. Brettspiele sollen mir eine gute Zeit am Tisch liefern. Etwas, was ich nicht von anderen Medien bekomme. Warum? Mein Gehirn schreit nach Nahrung. Ich möchte abends denken, grübeln, mich darüber austauschen, Taktiken wählen, lachen, sprechen, würfeln. Das kann ein Film nicht. Also spiele ich mit meinen Menschen. In meinem Happyplace. Ich spiele gerne ein Mombasa und mag die Neuauflage nicht. Das ist meine Perspektive, ich gestehe jedem anderen Menschen seine Perspektive zu. Ich wäre glücklicher gewesen, man hätte Mombasa neuaufgelegt und das Spiel kritisch aufgearbeitet, geschichtlich eingeordnet o.ä. und es als das gelassen was es ist. Ein Produkt zu der entsprechenden Zeit und eben diese Zeit eingeordnet.
Was macht uns daher aus? Ich beziehe die Frage auf mich. Was macht mich aus? Ich bin ein toleranter Mensch. Und das im tiefsten Kern. Ich lasse jeden Menschen so leben wie er möchte. Ich tratsche selten und urteile wenig. In Bezug auf viele Themen der aktuellen Zeit, halte ich mich bewusst raus, weil ich im Kern kein politischer Mensch bin. Ich mag es lieber, meine Freunde zu bewirten und bin gerne Gastgeber. Ich unterhalte mich lieber darüber, wie man ein perfektes Kartoffelpüree zubereitet, anstatt über den neusten Aufreger aus der Politik. Ich greife die Themen der Zeit auf und bearbeite sie in meinem Rahmen. Über den Diskurs kommen eben bei mir neue Perspektiven dazu. Wir fahren „nur“ ein Auto, weil ich denke vieles ist eine Frage der Organisation und ist (auch) ein Betrag zum Thema Umweltschutz. Dabei würde ich niemandem vorschreiben: „Du muss…“ Viele Dinge muss jeder für sich in seinem Kosmos entscheiden. Ich schaue keine Nachrichten oder Medien, weil mich diese negativen Nachrichten auffressen, ich es nicht ertrage wie die Medien uns lenken. Ich esse gerne Fleisch. Früher fast täglich, mittlerweile brutal reduziert. Ich liebe Tofu und Soja etc. Mein Rind kaufe ich beim Biobauern vor Ort. Du möchtest Vegetarier sein? Dann gerne. Ich koche vegetarisch für dich wenn du mich besuchst, aber bitte schreibe mir nicht vor was ich esse. Das ist für mich Toleranz. Und soll ich was sagen. Ich bin ein männlicher weißer Mann. Ich bin auch so sozialisiert worden. Mein Vater ist Arbeiter, meine Mutter Hausfrau. Ich bin mit Jean Claude van Damme, Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stalone großgeworden. Ich habe viele klassische Erziehungsrollen kennengelernt. Ich würde mich als dominant beschreiben. Gleichzeitig bin ich auch zufällig ein Mann. Das ist aber mittlerweile fast „beschämend“ zu sagen. Bevor jetzt viele in die Tasten hauen gebt mir ein paar Sekunden. Ich bleibe bei meinem eingeschlagenen Weg. Ich nehme viele Dinge aus allen Diskussionen mit. Mein Habitus (um bei Christians und meinem geliebten Bordieu zu bleiben) ist durch meine Erziehung und mein Umfeld geprägt, verändert sich und war und ist stets durch Offenheit und Neugier geprägt. Also bin ich tolerant gegenüber allen Menschen. Ein echter Menschliebhaber. Auch wenn meine Prägung eher so ist, wie oben beschrieben, habe ich keine Berühungsängste mit allem anderen. Im Gegenteil, denn der Diskurs verlangt danach. Ich bewerte Menschen nach meinem Empfinden. So kann ich mit Ansichten von einigen CIS Männern nichts anfangen, fühle mich deutlich mehr hingezogen zu Menschen mit anderen Prägungen oder Vorlieben. Diese Attribute beschreiben auch nicht das. Weil diese Dinge sind mir egal. Für mich zählt der Mensch. Unabhängig von irgendwelchen Merkmalen. Allerdings würde ich mir das von der angeblich toleranten Community auch für mich wünschen.
Ein letzter Brückenschlag. Habe ich meinen Happyspace? Ja! Natürlich. Ich spiele gerne mit den Menschen bei denen ich weiß, dass sie meine Ansichten und Attribute teilen. Weil sie mir ein tolles Erlebnis und eine gute Zeit ermöglichen. Lerne ich gerne neue Menschen kennen? Ja! auf jeden Fall. Mein Tisch ist offen, aber ich wähle in der Reflexion die Menschen aus, die o.g. Bedingungen erfüllen. Ich spiele nicht gerne mit Menschen, die eine Downtime kreieren oder alles zerdenken, weil es nicht zu meinem Erlebnis und Spielgefühl passt. Reflektiere ich mein Verhalten? Natürlich, sonst würde ich hier garnicht sitzen und schreiben.
Das sind alles meine Gedanken. Niemand muss diese als richtig oder falsch übernehmen. Ich möchte und werde niemanden bekehren wollen. Ich freue mich über eure Ansichten, aber bitte auf der Ebene des Diskurses, den Christian zu diesem Thema angestoßen hat. Oder auch nicht.
Viel wahres dran. Generell ist es verboten zu verbieten! 🦉 Daran sollte man sich immer halten, besonders bei Hobbys.
P.S
Du hast dem armen Pierre ein U geklaut…
Hallo Lieber @Christian!
Vielen Dank für diesen tollen Beitrag. Ich stimme deinen Punkten sehr zu. Und ich möchte auch gerne meine Perspektive dazu geben.
Was möchte ich von einer Rezension/Beitrag?
Ich lese hier sehr gerne und aufmerksame, weil ich in erster Linie das Gefühl habe, 2 tollen Menschen bei klugen Gedanken beobachten zu können. Und so gehe ich bei allen Medien vor, die sich aus einem Hobby heraus entstanden sind.
Ich mag Fußball – da höre ich den Rasenfunk. Warum? Weil ich den Blick von Max und seinen Gästinnen sehr schätze. Dabei ist das Was für mich weniger wichtig, als das Warum sie etwas sagen. Nach vielen Jahren des Hörens ist der Rasenfunk deutlich professioneller geworden. Und das im positivsten Sinne. Und gleichzeitig höre ich Minutenweise Kein Pardon. Ein Podcast über den Film Kein Pardon. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was man zu jeder Minute Kein Pardon sagen kann und ob das nicht mal langweilig ist. Manchmal nichts und manchmal schon 😉
Und das finde ich ganz toll. Ich entscheide nach meinem Gemüt (auf jeden Fall in meiner Top 3 der schönsten deutschen Wörter) und meiner Stimmung was ich mir aussuche.
Und aktuell sehe ich noch gute Chancen, diese große Bandbreite im Hobby Brettspiel zu implementieren und auch einen Mehrwert für Verlage etc. zu zeigen. Manche andere Bereiche sind da schon deutlich fester gefahren imho.
Jedoch sehe ich auch die Gefahr in dem, wofür Happyworld ein Symptom sein kann. Grundsätzlich finde ich es ein sehr schönes Ziel, wenn es im Hobby darum geht eine möglichst gute Zeit zu haben. Aber es verleitet vielleicht auch dazu, faul zu werden und zu denken: na ja, ich habe ja eine gute Zeit und ich hindere niemand bewusst auch Spaß zu haben – alles fein also?
Mitnichten! Ich denke, wenn wir uns im Hobby das Ziel setzten, möglichst inkludierend zu sein, dann heißt das, aktiv die eigene Wirkung zu reflektieren, Feedback einzuholen und zu gucken, was Menschen brauchen, um am Hobby teilnehmen zu können.
Und da sehe ich uns Content Creatoren in der Verantwortung, sofern wir die Offenheit für uns in Anspruch nehmen wollen. Ein Beispiel, was ich meine: ich freue mich, wenn jemand von seinem All-in supa dupa Awaken Realms BuBu extrem erzählt und das präsentiert. Gleichzeitig muss man sich aber bewusst machen, dass der 14-jährige Dennis, falls er so zu ersten Mal auf diesen Kanal gestoßen wäre, sich das niemals hätte leisten können und sehr traurig darüber gewesen wäre.
Heißt das, man darf diese Spiele nicht mehr zeigen? Auf keinen Fall, aber man kann vielleicht auch Tipps an die Hand geben, wie man BuBu kostengünstig trotzdem erleben kann.
Was hat das alles mit dem Content zu tun, den wir schaffen?
Ich denke, dass sollte vielmehr die Frage sein. Nicht die Form ist entscheidend, sondern wie wir es schaffen können, unsere Zugänglichkeit zu erhöhen. Wie kommen wir mit Menschen in Kontakt, die uns als zu kompliziert, zu erdig, zu exkludierend erscheinen? Was können wir machen, damit diese Menschen Spaß haben, dabei zu sein.
Und wo lassen wir sie in Ruhe und gehen ihnen nicht mit unserem Quatsch auf die Nerven?
Wenn wir es schaffen, da nicht mehr als die „Bubble“ gesehen zu werden, sondern einfach auf die Personen reagieren, die uns umgeben (sei es am Tisch, im Podcatcher, beim Lesen des Blogs usw.) und diesen eine möglichst einfache Zugänglichkeit gewähren, dann ist das meiste geschafft.
Und wenn ich sage: hier, das sind meine Gedanken. Ich lade niemanden ein, teilzunehmen. Ich möchte nicht offen sein, sondern biete lediglich etwas an, auf das ich keine Reaktion haben möchte, dann ist das auch fein. Diese Menschen können auch sagen: Spiel XY ist Mist und es findet hier nicht statt. Ich bin nur und ausschließlich für mein eigenes Vergnügen hier.
Und dann steht es den Menschen ja frei, wo sie sich hin begeben wollen. Ich verurteile es übrigens überhaupt nicht, wenn Menschen solche Art von Content generieren und sich öffentlich äußern. Sowas konsumiere ich auch und es hilft mir, weil ich weiß, das ich nur passiv konsumiere und gar keine Response erwartet wird.
Was allerdings nicht geht, ist Offenheit zu fordern oder zu behaupten, man lebe diese und anschließend eben doch nur und ausschließlich Content macht, um sich selbst zu feiern. Dann nenne ich das bigott. Und das nervt mich kolossal.
Und ich möchte hier niemanden angreifen. Leute, seid einfach wie ihr seid. Aber lasst doch dann vielleicht den Anspruch weg, es „richtig“ machen zu wollen. Das gibt es nämlich nicht. Noch nicht mal ansatzweise. Habt einfach mehr Spaß, sucht das Vergnügen und teilt es mit anderen Menschen. Wir können noch viel mehr Diskurse, Unterhaltungen usw. im Hobby gebrauchen. Braucht es den einen nächsten Brettspiel Podcast? Nein! Es braucht noch 100! Braucht es den nächste Blog über Kickstarter und Co.? Ja, und stifte bitte 5 andere Personen an auch was zu starten. Sollte ich jetzt noch einen Youtube Kanal aufmachen? Schreib mich an, ich bin morgen dein erster Abonnent und gucke mir dein Zeug an.
Muss mir der Content gefallen? Zum Glück überhaupt nicht. Weder Form noch Inhalt. Und trotzdem finde ich es großartig, wenn neue Dinge entstehen und vergehen oder bleiben.
„Und wo lassen wir sie in Ruhe und gehen ihnen nicht mit unserem Quatsch auf die Nerven?“
Vielleicht mal hier anfangen:
„…und seinen Gästinnen…“
Das verstehe ich nicht!
Genau das:
Wenn Dennis oder andere Gendern, ist das seine Entscheidung und muss nicht kommentiert werden. Du kannst gerne eine andere Meinung dazu haben. Das ist auch mein Tenor des Artikels. Du kannst gerne auch das Gendern als Quatsch abtun. Aber es geht nicht um das Gendern.
Brett & Pad ist kein Blog über das Gendern. Brett & Pad ist ein Brettspieblog und Christians Frage beleuchtet eine spezielle Frage. Und du kannst Dich gerne inhaltlich äußern, aber dann nicht dir einen Aspekt rauspicken und alle anderen Nuancen und Ebenen ignorieren. Das funktioniert nicht und möchte ich auch nicht. Jeder hat eine andere Perspektive und wenn dich das Gendern nervt, ist das deine Entscheidung, aber sie ist nicht allgemeingültig. Die Frage von Dennis verlangt keine Antwort sondern ist vage in den Raum formuliert und sollte (das war auch Christians Ansatz) aus vielen unterschiedlichen und inhaltlichen Perspektiven entsprechend der Frage beleuchtet werden.
Wie Du weiter oben schon angemerkt hattest:
„Gleichzeitig bin ich auch zufällig ein Mann. Das ist aber mittlerweile fast „beschämend“ zu sagen.“
Offensichtlich!
Meine Einlassung bezog sich auf die von bestimmten Kreisen aufoktruierte Vergewaltigung der gewachsenen deutschen Sprache durch permanentes sog. „Gendern“, besonders wenn es wie hier schon so weit getrieben wird, dass jetzt das generische Femininum verwendet wird.
Und es wurde ja ausdrücklich nach Meinungen gefragt.
Hier also meine: Blogs, Videos oder sonstige Beiträge mit missionarischem Gendern meide ich aus Gründen der Wertschätzung meiner MUTTERsprache!
So, und jetzt noch viel Spass hier!
Wann wird es endlich wieder so, wie es niemals war?
Gottsched, Lessing und Goethe kannten noch „Verwandtinnen“ und „Bekanntinnen“. „Studirende“ – bis ins 19. Jahrhundert die gebräuchliche Form. Tja…
Lass doch Dennis den Goethe machen, wenn er mag.
@Dennis ihr habt im Podcast euch gefragt, was ihr tun könnt. Da gibt es meiner Meinung nach zwei konkrete Dinge: Sichtbarkeit und Querverweise. Konkret: ladet Frauen in euren Podcast ein, sagt bei einem Spiel einer Autorin den Namen, nennt die Illustratorinnen, verweist auf Blogs, Podcasts von Frauen, POC und LGBTQ*. Das könnt ihr ganz nebenbei immer wieder tun.
Auch umgekehrt, sichtbar machen, wie einseitig es ist:
Sagt auch wenn es nervt, dass schon wieder einer der fünf Männer das gleiche Cover in den gleichen gedeckten Farben gemalt hat.
Denn auch das schafft diese Membran: wenn alles so aussieht wie es dem harten Kern gefällt, dann bleibt der Kern schön unter sich.
Schöne Podcastfolge. Danke!
Nur als Nachfrage, welcher Podcast/Folge? In der verlinkten von mir spricht Olli und Tim von den Teilzeithelden. Nur damit da nichts verwechselt wird.
Und mit dem *was können wir tun“ hast du mit deinen Vorschlägen sicher recht, auf der anderen Seite bezweifle ich, dass es so einfach ist. Die Zahl der Frauen im Berufsfeld Brettspiele stagniert seit Jahren bei 2% (laut Quellen von Tag der Brettspielkritik), trotz Bemühungen. Treten wir vom Geschlecht zurück und betrachten „weißsein“, wird es noch schwieriger. Wenn ca. 25% der Menschen in Deutschland einen Migrationshintergrund besitzen, aber dies das Hobby null abbildet. Wie sehr sind auch Milieus ausgegrenzt? Da sind wir dann im Klassismus. Die Genderdebatte und eine dortige Gleichberechtigung im Hobby ist wichtig, aber insgesamt ist ein Fokus darauf, gerade für diese Membran zur Blase zu eng geführt.
Es gibt viel zu tun, es wäre aber aus meiner Sicht falsch zu denken, dass diese tiefen gesellschaftlichen Probleme, die stark abseits des Hobbys sich manifestieren, einfach zu lösen sind. Das war auch Teil der Diskussion in einem Workshop und die Praxis ist nicht einfach (Es wurde z.B. von Brettspiel AGs mit syrischen und deutschen Kindern gesprochen und die kulturelle Differenz beim Verständnis über das gemeinsame spielen). Das ist keine Ausrede es nicht zu versuchen und sein Handeln zu reflektieren, die Membran durch Austausch und Veränderung im eigenen Handeln durchlässiger zu machen, ist wichtig. Das geschieht hier ja im Kleinen. Trotzdem ist die Herausforderung komplex. Und ich vermute, es reicht bei weitem nicht, einfach nur Frauen in ein Podcast einzuladen. Oder auf ein Podium zu setzen … wo dann weiße Männer am Ende trotzdem widersprechen.
Danke – das sind immer gute Impulse. Wenn ich so reflektiere, ist das unbewusst auch schon passiert. Allerdings ist es ja ein riesen Unterschied, ob einem das „mal raus rutscht“ oder man bewusst die Dinge auf den Tisch bringt.
Daher sind wir auch immer dankbar über Feedback und Impulse, Dinge anders zu machen/betrachten. Und laden aktiv dazu ein.
Denn auch wir unterliegen ja dem Phänomen, dass wir Dinge als selbstverständlich erachten die unserem Geschmack etc entsprechen. Manchmal muss man gegen die Ecken geschubst werden, wie man nicht spürt in seiner Unbeweglichkeit.
Ich freue mich, falls du mal eine Folge hörst und in unserem Discord da deine Gedanken teilst.
Ah ich dachte das sei jemand aus dem verlinkten Podcast hier. Ich habe den Podcast nicht im Abo, sondern nur die hier verlinkte Folge gehört.
Einfach ist es sicher nicht und vieles hat in der Tat mit der Gesellschaft, Milieus, Klassen und Integration und Verteilung von Care Arbeit zu tun…
Aber als kleinen Start, kann man die wenigen, die es aus der Minderheit in die Blase schaffen, besonders herzlich willkommen heißen und hier und da featuren.
Leider passiert zu oft noch das Gegenteil, neue Autorinnen werden extra kritisch beäugt, Illustratorinnen der Unfähigkeit beschimpft (z.B. Carpe Diem), neue Menschen auf Spieletreffs nicht gut hinein geführt.
A long way to go. Vor allem als Gesellschaft.
Schönes Wochenende!
Danke @Markus
Stand gerade auf dem Schlauch, was jetzt los sein soll.
Aber @KK falls dich meine Sprache stört, ist das nicht schlimm. Du darfst gerne virtuell, für dich, die Worte, die dich stören, austauschen. Das paßt für mich 😊
Viel könnte ich jetzt zum Thema Gendern mit euch teilen – und das exklusiv aus weiblicher Perspektive. Einer Perspektive, die es lange Zeit nicht für notwendig hielt. Vielleicht, weil meine Sozialisation es nicht für notwendig hielt. Vielleicht, weil ich stillschweigend davon ausging, mein Ausgangspunkt sei auch der der anderen. Doch – welch Glück –, wenn einem irgendwann der Blick über den eigenen Horizont gelingt.
Daher: genug dazu. Und zum Wesentlichen.
Was euch ausmacht
Für mich ist es die Art und Weise, wie ihr Emotionen spürbar macht. Wie ihr uns als Leserschaft an euren Tisch holt – in eure Familien, eure Spielrunden, eure Gedankenwelten. Gerade darin gelingt euch die Verbindung zu etwas Größerem, einer darüber hinausreichenden Metaebene.
Denn Brettspiele sind nicht einfach nur Spiel. Sie schaffen Verbindung. Sie bringen Menschen zusammen, ermöglichen Perspektivwechsel, laden zum gemeinsamen Erleben ein. Und genau darin liegt ihre Kraft.
Ich glaube daran, dass jede*r von uns die Welt ein kleines Stück mitgestalten kann – indem wir unseren eigenen Mikrokosmos bewusst prägen. Daraus entstehen Kreise, die sich nach außen ausdehnen. Nicht immer laut, nicht immer sichtbar, und selten mit unmittelbarer Wirkung. Aber sie hinterlassen Spuren.
Eure Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Themen steht nicht laut im Vordergrund – und genau das macht sie so wirkungsvoll. Sie ist ehrlich, spürbar. Und sie gründet auf einem starken Fundament: Toleranz. Nicht im Sinne bloßer Duldung, sondern als echte, gelebte Akzeptanz. Eine Haltung, die niemanden an den Rand drängt – weder im Spiel noch darüber hinaus.
Und wenn wir schon beim Essenziellen sind:
Zu einem richtig guten Kartoffelpüree gehören nichts als beste Zutaten – gute Kartoffeln, Butter, Sahne, Milch, Muskat, Salz, Pfeffer … und, ja, ein Spritzer Maggi. Sonst kaum in Gebrauch, aber hier: unverzichtbar.
Maggi und Sahne? Ins Püree?!? Was zur Hölle?!
Das sind ja die UNO und Monopolys der Kochszene 😂
Ich glaube hier will uns jemand provozieren 😜 Markus hilf!
Dabei wissen wir doch, die Geheimzutat in Kartoffelmus ist Knoblauch und Hönigsenf!
Ansonsten möchte ich den tollen Kommentar aber nicht darauf reduzieren. Also Korselkopf, vielen Dank für eine weitere Perspektive. Ich finde es sehr spannend, wie unterschiedlich ihr in Details für euch diese „Metaebene“ bearbeitet.
Provozieren?! Ich? Wenn schon vergiften. Nach alter Hexenmanier.
Vielleicht sind meine Zutaten wie monopoly und Uno – ein bißchen verpönt und doch hatten wir alle irgendwann mal Freude damit. Zumindest bis jemand die ersten Häuser auf der Schlossallee stehen hatte.
@christian: für mich klingt Mus, Knoblauch und Honigsenf extrem wild übers Katoffelfeld galoppiert.
Aber eben das liebe ich: dass Geschmack genauso vielfältig ist wie Haltung.
Und Haltung muss nicht laut sein. Manchmal reicht es, still und klar an der eigenen Linie festzuhalten.
Just trust the taste.
Das traurigste am Kartoffelpüree ist, dass es auch Pommes hätten sein können 😅
Also ich habe Kartoffelpüree noch nie so gemacht, wie ihr beide beschreibt. Aber das klingt beides spannend 🤗
Hi, ich persönlich liebe den Namen Kordelkopf und tatsächlich interessiert mich die Geschichte hinter dem Namen? Sollte es eine geben. Ich mag die weibliche Perspektive immer sehr. Sie ermöglicht es mir, breiter im Umgang mit Menschen zu kommen. Ich würde behaupten ich habe in meinem Leben mehr mit der weiblichen Perspektive kommuniziert als mit der männlichen Perspektive.
Tatsächlich öffne ich persönlich sehr viel Einblicke in viele Bereiche die mich ausmachen. Das mag ich und ich bedanke mich für deine wertschätzende, sensible Rückmeldung.
Zum Thema Kartoffelpüree. Christian versucht schon länger dieses Knoblauch und Honigsenf Ding. Ja, es ist lecker. Aber wir sind uns doch einig, dass die Kartoffel der Star ist? Daher….Kartoffel Stampfen, Milch mit Muskatnuss, Salz und Pfeffer und dann: 250g Butter in feinen Flocken in die Püree mit einem Schneebesen einmassieren.
⬆️ this ⬆️
Das fand ich auch ganz interessant zu einem hier angesprochenen Aspekt:
https://opinionatedgamers.com/2025/07/21/alison-brennan-game-snapshots-2025-part-19/#more-86396